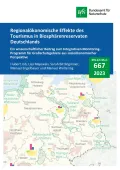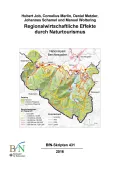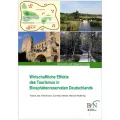Schutzgebiete und Tourismus
Tourismusentwicklung in Schutzgebieten
Mit jährlich rund 696 Millionen einzelnen Besuchstagen durch Gäste und Erholungssuchende gehören die Nationalparke, Biosphärenreservate und Naturparke als Teil der 141 Nationalen Naturlandschaften zu nachgefragten Naherholungs- und Reisezielen Deutschlands. Diese Tendenz hin zu mehr Freizeit in und mit der Natur bedeutet aber auch ein erhöhtes Gästeaufkommen in ökologisch sensiblen Gebieten und damit einen weiter steigenden Druck auf diese Landschaften und der damit verbundenen Flächennutzung. Schutzgebiete bieten als Modellregionen die Möglichkeit, Konzepte für eine naturverträgliche und nachhaltige Tourismusentwicklung umzusetzen, ortsansässige Akteure einzubinden und damit positive regionalwirtschaftliche Effekte zu erzielen. Die im Folgenden vorgestellten Projekte des BfN dienen der Umsetzung dieser Ziele.
Regionalökonomische Effekte von Tourismus in Nationalen Naturlandschaften
Die Regionen erwirtschaften mit dem Tourismus durch die Nationalen Naturlandschaften jährlich 14 Milliarden Euro, die aus den Ausgaben der Tages- und Übernachtungsgästen resultieren. In meist ländlichen Regionen generieren die Schutzgebiete damit erhebliche regionale wirtschaftliche Effekte und sichern Arbeitsplätze vor Ort, wie Kennzahlen aus touristischen Wertschöpfungsanalysen zeigen. Die regionalökonomischen Effekte von Tourismus sind für die nachhaltige Regionalentwicklung von besonderer Bedeutung und spielen eine wichtige Rolle im sozio-ökonomischen Monitoring. Ihre Messung erfordert bundesweit einheitliche Methoden.
Projekte
Im Rahmen von mehreren, in Teilen aufeinander aufbauenden FuE-Vorhaben wurden die regionalökonomischen Effekte des Tourismus in Schutzgebieten umfassend untersucht, die folgend kurz skizziert werden.
In einer Studie zum Total Economic Value wurde die Wertschätzung der Bevölkerung für die Nationalen Naturlandschaften ermittelt. Einer repräsentativen Umfrage zufolge ist den Menschen der Schutz dieser Landschaften rund 40 Milliarden Euro wert. Grundlage dieser Berechnung ist eine Zahlungsbereitschaftsanalyse, bei der die Befragten angaben, welchen Beitrag sie bereit wären hierfür zu leisten.
Anknüpfend an die bisher durchgeführten Vorhaben zu den positiven wirtschaftlichen Effekten von Tourismus in Nationalparken und Biosphärenreservaten wurde im Rahmen des Vorhabens die Methodik auf die deutschen Naturparke übertragen und u.a. eine Abschätzung der regionalwirtschaftlichen Effekte des naturnahen Tourismus in Naturparken für Gesamtdeutschland geliefert. Jedoch lassen sich nicht in allen 104 Naturparken die Erhebungen durchführen, weswegen im Projekt eine Methodik entwickelt wurde, die Ergebnisse der empirischen Erhebungen in einigen Naturparkmodellregionen auf alle deutschen Naturparke hochzurechnen. Diese Ergebnisse sowie die Ergebnisse aus den Erhebungen der regionalökonomischen Effekte von Tourismus in Nationalparken und Biosphärenreservaten ermöglichen erstmalig eine Gesamtbetrachtung der wirtschaftlichen Wirkungen dieser drei Schutzgebietskategorien.
In dem Projekt wurden Erfolgsfaktoren für die Implementierung eines nachhaltigen Tourismus in Biosphärenreservaten sowie ökologische und sozioökologische Wirkungen identifiziert. Dabei wurden modellhaft mit und für die BR partizipativ Strategien entwickelt, wie Synergien zwischen Tourismus und anderen (nachhaltigen) Landnutzungen bzw. Wirtschaftsweisen verstärkt genutzt und in existierende Schutzgebietsstrategien integriert werden können. Die Ergebnisse haben gezeigt, dass nachhaltige Tourismusangebote sich vor allem dann erfolgreich umsetzen lassen, wenn sie auf die entsprechenden Präferenzen und Akzeptanz bei Besucher*innen und Gästen treffen. Nachhaltige Produktkennzeichnungen wie die BR-Partner*innen oder Regionalmarken stärken die Transparenz und Glaubwürdigkeit und schaffen mehr Sichtbarkeit und ein emotionales Kommunikationsumfeld. Die Ergebnisse sind in der BfN-Schrift 674 veröffentlicht.
Die zwei Studien untersuchten 2016 in sechs und 2022 in allen 18 deutschen Biosphärenreservaten den Stellenwert des Tourismus für die jeweilige regionale Wirtschaft. Das Ergebnis hochgerechnet auf Deutschland: Die 18 UNESCO-Biosphärenreservate zählen jährlich insgesamt rund 71 Millionen Besuchstage, die einen Bruttoumsatz von 3,8 Milliarden Euro bewirken. Die Studien belegten, dass der Tourismus in Biosphärenreservaten einen beachtlichen wirtschaftlichen Beitrag für die Regionalwirtschaft leistet. Gleichzeitig ist die erfolgreiche Vermarktung touristischer Angebote ein wertvoller Beitrag, um in der breiten Öffentlichkeit die Marke „UNESCO-Biosphärenreservat“ bekannter zu machen. Die Ergebnisse sind in NaBiV 134 und in der BfN-Schrift 667 veröffentlicht.
Aufbauend auf den vorliegenden empirischen Ergebnissen für alle deutschen Nationalparke erfolgte eine tiefer gehende Analyse mittels einer Sensitivitätsanalyse zur Abschätzung der Methode als eigenständiges Monitoringinstrument. Dabei wurden sowohl die Ergebnisse zur Bestimmung der Besucherzahl als auch die aus den Interviews gewonnen Informationen berücksichtigt. Die Ergebnisse der Analyse der empirischen Daten dienen als Basis für den Entwurf einer Monitoringkonzeption zur Bestimmung der regionalökonomischen Effekte des Tourismus in Nationalparken. Die Ergebnisse wurden als BfN-Skript 431 veröffentlicht.
In der Studie wurde die Bedeutung des Tourismus in Nationalparken für die jeweilige regionale Wirtschaft bestimmt. Dies stellt sich im Gesamtergebnis wie folgt dar: Pro Jahr weisen die Nationalparke 53 Millionen Besuchstage auf, die einen Bruttoumsatz von rund 2,8 Milliarden Euro bewirken. Die Ergebnisse der Studie belegen, dass der mit Nationalparken verbundene Tourismus einen beachtlichen wirtschaftlichen Beitrag für die Region leisten kann. Des Weiteren gibt sie detaillierten Aufschluss über Besuchsstrukturen und Motivation von Gästen in den Nationalparken Deutschlands und enthält wertvolle Hinweise für eine nachhaltige Tourismusentwicklung im Umfeld der Nationalparke. Die Ergebnisse sind in NaBiV 76 und BfN-Schrift 431 veröffentlicht.
Im Rahmen eines FuE-Vorhabens wurde eine Methode zur Quantifizierung touristisch induzierter regionalökonomischer Effekte in Großschutzgebieten (GSG) erarbeitet. Die Ergebnisse des Vorhabens sind in einem Leitfaden zur Erfassung der regionalwirtschaftlichen Wirkungen von Tourismus in Großschutzgebieten, BfN-Skript 151, veröffentlicht.
weiterführender Inhalt
Partner der Nationalen Naturlandschaften
Nachhaltige Tourismusentwicklung in Schutzgebieten gelingt nur unter Mitwirkung der touristischen Leistungsträger und regionaler Betriebe vor Ort. Beispielhaft stehen dafür die "Partner der Nationalen Naturlandschaften". Seit 2008 haben sich in verschiedenen deutschen Nationalparken, Naturparken und Biosphärenreservaten Kooperationen zwischen Schutzgebietsverwaltungen sowie regional ansässigen, vorwiegend touristischen Unternehmen gebildet. Diese sogenannten Partnerbetriebe werden nach bundeseinheitlichen Qualitäts- und Umweltstandards zertifiziert. Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, ihr Angebot qualitativ hochwertig sowie natur- und umweltverträglich zu gestalten, beständig zu verbessern und dem Gast eine ansprechende Palette an Naturerlebnissen anzubieten. Als serviceorientierte Botschafter ihres Schutzgebietes unterstützen die Partner die Schutzgebietsverwaltungen und sind Vorreiter für einen nachhaltigen Tourismus. Partnerbetriebe aus den Bereichen Hotellerie, Gastronomie, Handwerk, Führungen u.a. arbeiten inzwischen in ihren regionalen Netzwerken mit den Schutzgebietsverwaltungen zusammen und identifizieren sich mit den Schutzgebietszielen. Sie werden auf den Seiten der Nationalen Naturlandschaften geführt.
Ziele der Zusammenarbeit zwischen Schutzgebiet und Tourismus sind vor allem eine bessere Gästeinformation und -sensibilisierung sowie die Akzeptanzsteigerung der Schutzgebiete bei der einheimischen Bevölkerung, den regionalen Akteuren und politischen Entscheidungsträgern. Dabei sollen sowohl die Einheimischen als auch die Gäste von den angestrebten qualitativ hochwertigen und unter Nachhaltigkeitsaspekten gestalteten Angeboten in den Schutzgebieten profitieren. Die Schutzgebiete und Partner profitieren ihrerseits von einer stärkeren Vernetzung und verbesserten Zusammenarbeit.