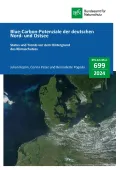Naturschutz und Klimawandel – eine nationale Aufgabe
Biodiversität und Klimawandel
Forschung und Entwicklung zu den Zusammenhängen zwischen Biodiversität und Klimawandel sind eine zentrale, fachübergreifende Aufgabe des BfN. Die Auswirkungen des Klimawandels auf die Biodiversität machen deutlich, dass der Naturschutz zunehmend dynamischer gedacht werden muss. Konkret geht es hier auch um Fragen der Ausgestaltung bisheriger und neuer Naturschutzinstrumente. Gleichzeitig leisten intakte, naturnahe Ökosysteme ihrerseits wichtige Beiträge für den Klimaschutz und die Klimaanpassung. Deshalb ist es entscheidend, Lösungsansätze zu entwickeln, die Synergien bestmöglich nutzen.
Ein vielversprechender Ansatz sind naturbasierte Lösungen, wie sie etwa im Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz (ANK) der Bundesregierung vorgesehen sind. Diese Maßnahmen verbinden den Schutz der biologischen Vielfalt mit dem Klimaschutz und der Klimaanpassung. Sie lassen sich in verschiedenen Landschaftsräumen umsetzen, sowohl in natürlichen als auch in vom Menschen genutzten Gebieten. Neben den Synergieeffekten von Biodiversitäts- und Klimaschutzpolitik müssen aber auch mögliche Zielkonflikte klar benannt werden, um zu vermeiden, dass Klimamaßnahmen umgesetzt werden, die sich negativ auf die Biodiversität auswirken.
Widerstandsfähige Natur – Ein Schlüssel im Kampf gegen den Klimawandel
Unsere Natur – also Wälder, Wiesen, Moore oder Flüsse – spielt eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, den Klimawandel zu begegnen. Doch der Klimawandel bringt viele Veränderungen mit sich. Zum Beispiel regnet es häufiger zu viel oder zu wenig – das stresst viele Lebensräume und kann ihre Stabilität beeinflussen. Deshalb setzt sich die Bundesregierung in verschiedenen Programmen und Strategien gezielt dafür ein, diese widerstandsfähigen Ökosysteme zu erhalten oder wiederherzustellen. Das bedeutet: Ökosystemen sind widerstandsfähig und können sich nach Störungen, wie etwa extremem Wetter, gut erholen und sich langfristig an die sich verändernden Klimaverhältnisse anpassen. Viel Biodiversität – also eine Vielfalt von Lebensräumen und Strukturen, Artenreichtum oder genetischer Vielfalt machen Ökosysteme häufig resilienter gegenüber den Auswirkungen des Klimawandels.
Damit die Ökosysteme auch in Zukunft funktionsfähig bleiben, braucht es durchdachte Resilienz-Konzepte. Wichtig ist dabei, dass diese auf einem klaren Verständnis davon basieren, wie Resilienz in der Natur funktioniert. Die Forschung zu diesem Thema wächst zwar, bleibt aber häufig sehr theoretisch. Es fehlt noch an konkreten Ideen, wie sich Klimaresilienz im praktischen Naturschutz umsetzen lässt. Noch ist oft beispielsweise unklar, wie stark ein Ökosystem sich verändern darf, bevor es sich nicht mehr erholen kann und wichtige Funktionen verloren gehen.
Genau hier setzt das Projekt „Klima-Resilienz von Ökosystemen – Konzepte, Bewertung und Handlungsempfehlungen“ an. Ziel ist es, herauszufinden, welche Merkmale besonders widerstandsfähige Ökosysteme ausmachen – heute und in Zukunft. Gleichzeitig sollen dabei verschiedene Perspektiven einfließen: Wie schnell verändern sich Lebensräume? Welche Rolle spielen Entscheidungen von Politik, Behörden oder Flächennutzern? All das soll dazu beitragen, Naturschutz auch unter den Herausforderungen des Klimawandels erfolgreich und zukunftssicher zu gestalten.
Naturverträgliche Klimapolitik
Der Klimawandel stellt schon heute eine Bedrohung für Menschen und Natur in Deutschland dar. Im Rahmen des Pariser Abkommens hat sich die Weltgemeinschaft 2015 verpflichtet, die Erderwärmung auf maximal 2 bzw. idealweise 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Um diese Ziele zu erreichen, haben sich Deutschland und die Europäische Union verpflichtet, ihre Treibhausgasemissionen bis 2030 um mindestens 40 Prozent im Vergleich zu 1990 zu reduzieren. Als Grundlage hierfür wurde in Deutschland das Bundes-Klimaschutzgesetz verabschiedet, welches die rechtlichen Rahmenbedingungen für den Klimaschutz festlegt. Zudem wurde 2024 das erste bundesweite Klimaanpassungsgesetz verabschiedet, das auf die konkrete Umsetzung von Anpassungsmaßnahmen fokussiert. Bestimmte Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen können jedoch eine Gefahr für die biologische Vielfalt darstellen. Insbesondere technische Lösungen sind oftmals mit Trade-offs verbunden. Andererseits weisen naturbasierte Lösungen häufig Synergien mit anderen Politikbereichen auf und können sich positiv auf Klimaschutz, Klimaanpassung und die biologische Vielfalt auswirken. Dieses Ziel, die Ausgestaltung und Umsetzung von Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel so weit wie möglich naturverträglich zu gestalten, ist so auch in der Nationalen Strategie zur Biologische Vielfalt (NBS 2030) verankert. Daher werden im Rahmen dieses Projektes die aktuell geplanten Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die biologische Vielfalt bewertet und Empfehlung für eine Optimierung von biodiversitätsschädigenden Maßnahmen entwickelt.
Fachtagung zu Naturschutz im Klimawandel
Der fortschreitende Klimawandel stellt auch den (behördlichen) Naturschutz vor neue Herausforderungen. Einige der bisherigen Instrumente und Strategien des Naturschutzes sind zu stark an statischen Leitbildern ausgerichtet und nicht im Hinblick auf eine derart schnelle Veränderung der natürlichen Gegebenheiten konzipiert worden. Bestehende Naturschutzkonzepte müssen deshalb wo nötig an die neuen Bedingungen angepasst werden.
Das BfN richtete hierzu vom 12. bis 13. November 2024 die Fachtagung „Naturschutzkonzepte im Klimawandel“ in Bonn aus. Die Veranstaltung brachte Teilnehmende aus der Wissenschaft, von Naturschutzbehörden und Naturschutzverbänden sowie weitere Akteure zusammen. Das Ziel war, einen Austausch zu den Themen und Handlungsbedarfen im Zusammenhang mit der Anpassung bestehender Naturschutzkonzepte an den Klimawandel zu ermöglichen. Dabei wurden nicht nur wissenschaftliche Erkenntnisse, sondern auch Praxiserfahrungen eingebracht und diskutiert. Die Veranstaltung bot eine Plattform für einen offenen Austausch für die Weiterentwicklung von Ansätzen, um Naturschutz, Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel synergetisch zu gestalten. Thematisch gliederten sich die zwei Tage in die Bereiche Artenschutz, Biotopschutz und Biotopverbund, Schutzgebiete sowie Renaturierung. Dazu wurden jeweils Vorträge gehalten und in Kleingruppen wurden diese Inputs dann aufgegriffen, diskutiert und mit den praktischen Erfahrungen der Teilnehmenden verknüpft.
Carbon Dioxide Removal
Die Reduktion der jährlichen Treibhausgas-Emissionen kommt in Deutschland aktuell nur schleppend voran. Auch das Erreichen der Pariser Klimaziele wird nach Einschätzung des Weltklimarats (IPCC) mit Hilfe der bisher getroffenen Klimaschutzmaßnahmen immer unwahrscheinlicher. Zudem ist mit schwer bzw. nicht vermeidbaren Restemissionen zu rechnen. Zukünftig an Relevanz gewinnen wird deshalb das Themenfeld Carbon Dioxide Removal (CDR). Dieses umfasst nach IPCC (2018) alle: „anthropogene[n] Aktivitäten, die CO2 aus der Atmosphäre entnehmen und langfristig geologisch, in terrestrischen oder marinen Ökosystemen oder in Produkten einspeichern“. Aktuell wird auf politischer Ebene die Anwendung einer Vielzahl von land- und ozeanbasierten CDR-Methoden von Aufforstung und Ozeandüngung bis hin zur direkten Abscheidung von CO2 aus der Umgebungsluft mit anschließender Speicherung (Direct Air Capture and Storage - DACCS) diskutiert. Auch der Fokus der 2024 veröffentlichten Eckpunkte zur Carbon-Management-Strategie der Bundesregierung liegt auf den Anwendungsmöglichkeiten von CDR in Deutschland im Hinblick auf unvermeidbare Restemissionen. Je nachdem welche Methoden genutzt werden und unter welchen Rahmenbedingungen diese zukünftig in Deutschland umgesetzt werden, können sich positive und/oder negative Folgen für die Biodiversität ergeben. Aus Sicht des Naturschutzes besteht hier noch vertiefter Forschungsbedarf, um eine fundierte Positionierung zu verschiedenen CDR-Methoden und ihren Auswirkungen auf die Biodiversität zu erlauben und Empfehlungen für eine biodiversitätsfreundliche Umsetzung von CDR-Methoden in Deutschland zu entwickeln.
Im Rahmen des Forschungsprojektes “Carbon Dioxide Removal – Potentielle Auswirkungen auf die Biodiversität“ wurden einige dieser Forschungslücken adressiert. Es wurde eine Literaturanalyse zum aktuellen Wissensstand von potentiellen Auswirkungen verschiedener CDR-Methoden auf die Biodiversität durchgeführt sowie die Positionen verschiedener Naturschutz-Akteure zu dem Thema abgefragt. Auch die aktuellen politischen Prozesse und Rahmenbedingungen zur Umsetzung von CDR wurden zusammengefasst. Das Ziel war, eine umfassende Einschätzung zu verschiedenen CDR-Maßnahmen aus Sicht des Naturschutzes zu erhalten
Wiedervernässung von Moorgrünland im Klimawandel
Der Verlust an Artenvielfalt und Lebensräumen sowie der Klimawandel bedingen sich gegenseitig und sollten bestenfalls auch zusammen adressiert werden, beispielsweise durch die Wiederherstellung klimarelevanter Ökosysteme. Dabei gewinnen Methoden zur Bewertung und Überwachung von Wiederherstellungsmaßnahmen unter Bedingungen des Klimawandels zunehmend an Bedeutung. Moderne wissenschaftliche Methoden wie der Einsatz von Fernerkundung und Modellierung bieten große Potenziale für eine effektive Umweltbeobachtung und -planung: Durch Satelliten, Flugzeuge oder auch Drohnen können vielfältige Informationen der Erdoberfläche gesammelt werden und in prozessbasierte Modelle eingehen, um komplexe Zusammenhänge in Ökosystemen untersuchen zu können.
Das Projekt mit dem Kurztitel „MoorgrünFE“ nutzt diese Ansätze, um die vielfältigen Wechselwirkungen zwischen abiotischen (Klima, Boden, Wasserhaushalt) und biotischen (Vegetation, Arten, Lebensräume) Faktoren in Mooren systematisch zu erfassen. Moore haben einen hohen Wert für den Klimaschutz. Sie können große Mengen CO2 speichern. Außerdem bieten sie Lebensraum für seltene Tier- und Pflanzenarten, die nur in diesem speziellen Lebensraum überleben können. Derzeit sind jedoch rund 90 Prozent der Moore in Deutschland entwässert, um die Flächen vor allem landwirtschaftlich nutzen zu können. Da Moore jedoch eine wichtige Rolle im Klimawandel spielen, gibt es derzeit große Bestrebungen, Moore wiederzuvernässen und ihnen so ihre natürliche Funktion als CO2-Senken zurückzugeben. MoorgrünFE hat sich zum Ziel gesetzt, Modelle zu entwickeln, mit denen die Prozesse der Wiedervernässung von Moorgrünland dargestellt werden können. Mit verschiedenen Fernerkundungsmethoden (Feldspektrometer, Drohnen mit Hyperspektralkameras, Satellitenbilder) werden Daten erhoben, auf denen prozessbasierte Modelle zur Simulation des organisch gebundenen Kohlenstoffs im Boden aufbauen. Auch die Pflanzendiversität, die Intensität der Landnutzung und der Bodenwassergehalt sollen mithilfe von Ansätzen der Fernerkundung und Modellierung abgebildet werden.
Statuskonferenz Biodiversität und Klimawandel
Die Folgen des fortschreitenden Klimawandels und des anhaltenden Rückgangs der Biodiversität sind auch in Deutschland bereits spürbar. Wissenschaft und Politik sind sich weitgehend einig, dass beide Herausforderungen überwiegend auf gemeinsame Ursachen zurückzuführen sind und sich aufgrund komplexer Wechselwirkungen gegenseitig noch weiter verstärken. Zu diesen Wechselwirkungen besteht jedoch noch erheblicher Forschungsbedarf. Um sich über Forschungsfragen zu aktuellen Themen an der Schnittstelle von Biodiversität und Klimawandel auszutauschen, veranstaltete das BfN im Dezember 2023 die Statuskonferenz „Biodiversität und Klimawandel – Synergien erforschen“. Sierichtete sich an die deutschsprachige wissenschaftliche Gemeinschaft mit dem Ziel, gemeinsam Wissenslücken und weiteren Forschungsbedarf zu aktuellen Themen im Bereich „Biodiversität und Klimawandel“ in Deutschland zu identifizieren. Mehr als 50 Teilnehmer*innen aus überwiegend wissenschaftlichen Institutionen nahmen an der Konferenz teil.
In World Cafés wurden Forschungsfragen vor allem in den Themenkomplexen „Wissenschaftskommunikation“, „Naturbasierte Lösungen“ und „Datengrundlagen“ am meisten priorisiert. Die identifizierten Forschungsschwerpunkte setzen thematische Prioritäten, um das Verständnis der komplexen Wechselwirkungen zwischen Biodiversität und Klimawandel weiter zu vertiefen und so die Entwicklung wirksamer und angemessener Lösungen für die Zwillingskrise aus Klimawandel und Biodiversitätsverlust in Politik, Praxis und Forschung zu fördern.