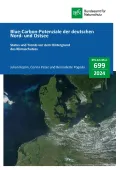Blue Carbon-Speicher erhalten und stärken
Carbon-Ökosysteme schützen und wiederherzustellen
Im Bemühen, die Blue Carbon-Ökosysteme zu schützen und oft auch wiederherzustellen, können die folgende Maßnahmen den natürlichen Klimaschutz im Meer stärken:
Klimaschutzzonen
Es gibt Überlegungen, Meeresökosysteme und vor allem marine Sedimente mit besonders reichhaltigen Kohlenstoffvorkommen vor schädigenden Eingriffen, wie z.B. mobiler, grundberührender Fischerei, zu schützen und als Klimaschutzzonen auszuweisen. Derzeit wird erforscht, welche Methoden und Daten notwendig sind, um mögliche „Kohlenstoff Hot Spots“ zu identifizieren.
Verringerung des Nährstoffeintrags
Eine verstärkte Reduzierung von Nährstoffeinträgen in Nord- und Ostsee ist wichtig, um Blue Carbon Ökosysteme wie insbesondere Seegraswiesen und Algenwälder und deren Kohlenstoffspeicherpotenzial zu erhalten. Dadurch würde das Wachstum der einzelligen Algen, die zu einer Trübung des Wassers führen, gebremst, und Seegraswiesen und Großalgen erhalten wieder ausreichend Licht für ihr eigenes Wachstum.
Wiederansiedlung von Seegraswiesen
Mit verschiedenen Methoden werden Seegraswiesen wiederhergestellt: Anpflanzungen, Einbringung von Saat, natürliche Wiederansiedlung nach Auffüllen von abgesenkten Sedimenten. Noch ist nicht abzusehen, ob die Wiederansiedlung dauerhaft gelingt, da die Überdüngung der Meere, der hohe Anteil an Schwebstoffen, veränderte Strömungen und die Erwärmung begrenzende Faktoren für das Wachstum der Seegraswiesen sind. Erste Projekte in Deutschland werden uns allerdings zeitnah eine Antwort liefern können.

Herstellung von natürlichen Überflutungsdynamiken von Salzwiesen und Küstenüberflutungsmooren
Viele Salzwiesen sind durch Deichbau und Entwässerung der natürlichen Überflutung entzogen worden. Dadurch können sie nicht mehr in dem für Salzwiesen typischen Maßstab Kohlenstoff langfristig binden und sind oftmals sogar zu Quellen von Treibhausgasemissionen geworden. Durch eine Öffnung von Sommerdeichen und einen Verschluss von Entwässerungsgräben kann man die natürliche Dynamik in Salzmarschen verbessern oder wiederherstellen. So wird die Salzwiese wieder häufiger überschwemmt und mehr Sediment auf die Salzmarsch gespült. Die sich entwickelnde Pflanzendecke fängt kohlenstoffreiches Material ein, welches durch den wassergesättigten Boden vor Zersetzungsprozessen geschützt ist.
Allerdings dauert es lange, bis eine wiederhergestellte Salzwiese voll funktionstüchtig ist:
Der Kohlenstoffspeicher einer wiederhergestellten Salzmarsch entspricht erst nach etwa 100 Jahren dem vergleichbarer natürlicher Salzmarschen.
Wiederherstellung biogener Riffe
Die Maßnahmen zur Wiederansiedlung der Europäischen Auster tragen zur Wiederherstellung biogener Riffe in der Nordsee bei.

Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz
Das Aktionsprogramm natürlicher Klimaschutz (ANK) der Bundesregierung verfolgt das Ziel, durch Schutz und/oder Wiederherstellung von natürlichen Ökosystemen ihre Klimaschutzleistung zu stärken. Im Handlungsfeld „Meere und Küsten“ des ANK sind zum einen Maßnahmen zur Wiederherstellung von Blue Carbon-Ökosystemen geplant. Des Weiteren sollen durch Forschung Wissenslücken über das Kohlenstoffspeicherpotential mariner Ökosysteme geschlossen werden, um die wissenschaftliche Basis für potentielle Wiederherstellungen von marinen Ökosystemen zu schaffen. Weitere Fragen betreffen u.a. die Machbarkeit und Erfolgsquote von Wiederherstellungen, die Kohlenstoffflüsse zwischen den verschiedenen Ökosystemen und den Einfluss von Beweidung in Salzwiesen auf Kohlenstoffspeicherung, Küstenschutz und Biodiversität.
Projekte des BfN zum Natürlichen Klimaschutz im Meer
Das Bundesamt für Naturschutz hat eine Reihe von Forschungsvorhaben gestartet, um Wissenslücken zu schließen:
Diese inzwischen abgeschlossene Literaturstudie präsentiert den aktuellen Wissensstand zum Blue Carbon-Potential von Salzmarschen, Seegraswiesen, unbewachsenen marinen Sedimenten, Makroalgen und biogenen Riffen. Ergebnisse zeigen, dass dieses Potential von verschiedenen Faktoren (z. B. Beschaffenheit des Meeresbodens, Bepflanzung, Störungsfrequenzen) abhängt. In Deutschland existieren bisher nur wenige publizierte, verwertbare und räumlich ausreichend gut aufgelöste Daten zum Blue Carbon-Potential. Jedoch ist in den kommenden Jahren aufgrund einer Vielzahl von neuen Projekten mit einem deutlichen Erkenntnisgewinn zu rechnen.
Die Studie verdeutlichte nochmals die Notwendigkeit, bereits vorhandene Blue Carbon-Speicher zu schützen und Lebensräume zu renaturieren, natürliche (Überschwemmungs-) Dynamiken wiederherzustellen sowie Nährstoffeinträge zu reduzieren. Gleichzeitig ist darauf zu achten, Stressoren und negative Auswirkungen zu verringern und ein ganzheitliches Management aufzubauen.
Das Forschungsvorhaben „Beitrag der Islandmuschel zur Kohlenstoffspeicherung und Biodiversität in der Ostsee“ untersucht, inwiefern die langlebige Islandmuschel zur langfristigen Kohlenstoffspeicherung beiträgt. Die Ergebnisse sollen auch eine Prognose zu ihrer zukünftigen Populationsentwicklung liefern. Schutzmaßnahmen sollen abgeleitet werden, um die Population der Islandmuschel und ihren potentiellen Beitrag zum Klimaschutz zu stärken.
Das Projekt „Studie zur Kohlenstoffspeicherkapazität mariner Sedimente in der deutschen Ostsee“ trägt dazu bei, die Kohlenstoffspeicherpotentiale mariner Sedimente in der deutschen Ostsee zu erfassen und zu bewerten. Dies beinhaltet die Kartierung der Sedimente zur Erstellung einer Verbreitungskarte der besonders kohlenstoffhaltigen marinen Gebiete. Ziel ist es, detaillierte Aussagen zu schützenswerten und für eine Wiederherstellung besonders geeigneten Regionen zu ermöglichen. Basierend auf dieser Karte könnten zukünftig Klimaschutzzonen identifiziert und ausgewiesen werden. Als Basis für diese sollen Messverfahren standardisiert werden, um national einheitliche Daten zu gewährleisten.
Das Forschungsvorhaben „Status der Funktionen biogener Riffe in der Ostsee mit Schwerpunkt auf die Kohlenstoff-Fixierung“ untersucht, ob Miesmuschelbänke in der Ostsee eine Kohlenstoffquelle oder -senke sind. Das Vorhaben erfasst die Ausdehnung der Miesmuschelbänke in der Ostsee, misst ihr Kohlenstoffspeicherpotential an ausgewählten Beispielen und modelliert die CO2-Bilanz unter heutigen und zukünftigen Bedingungen auf der Gesamtfläche in der deutschen Ostsee. Geeignete Managementmaßnahmen zum Erhalt des Natürlichen Klimaschutzes sollen daraus abgeleitet werden.
Das Forschungsvorhaben „Erforschung und Bewertung potenzieller Maßnahmen zur Erhöhung der Kohlenstoffaufnahme mariner Ökosysteme unter dem Aspekt ihrer ökologischen Auswirkungen und naturschutzfachlichen Möglichkeiten in der deutschen Nordsee“ bearbeitet zwei Schwerpunktthemen: 1) Erforschung und Bewertung des Kohlenstoffspeicherpotentials von Miesmuschel- und Austernbänken in der deutschen Nordsee, 2) Erforschung der Auswirkungen der Alkalinitätserhöhung (künstliche CO2-Entnahme) auf benthische Organismen.
Das Bundesamt für Naturschutz unterhält seit 2023 drei Datentonnen in den Meeresschutzgebieten der Ausschließlichen Wirtschaftszone. Diese Messysteme sollen mit Sensoren zur Erfassung von Methan und Kohlendioxid, in der Wassersäule und der Atmosphäre ergänzt und um drei weitere Datentonnen erweitert werden. Diese regelmäßig erhobenen Daten liefern Einblicke in die Veränderungen der THG-Konzentrationen in den Meeresschutzgebieten, um frühzeitig Maßnahmen entwickeln zu können.